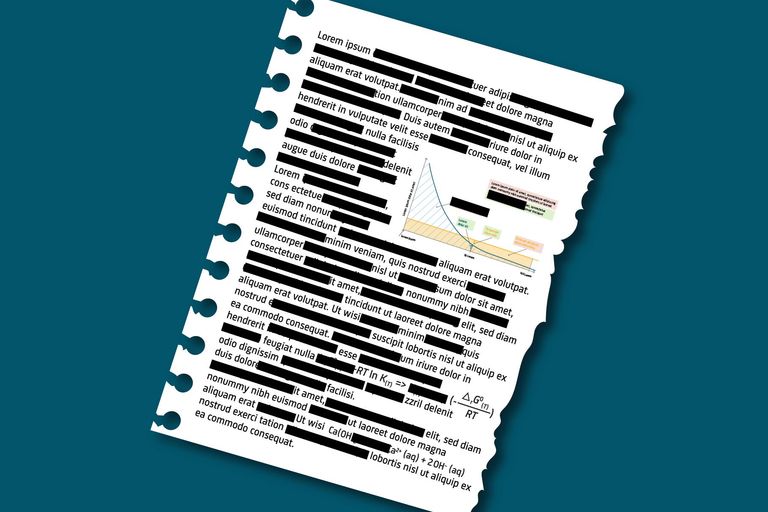Forschung zwischen Sicherheit und Freiheit
Über die Forschungszusammenarbeit mit autokratischen Staaten
Sie ist ein bedrohtes Gut – um so mehr gilt es, sie zu schützen: Die akademische Freiheit. Doch was bedeutet das für die internationale Zusammenarbeit in der Wissenschaft? Wie können Universitäten internationale Forschende vor Repressalien schützen? Und wie Forschungseinrichtungen Spionage begegnen? Die Tagung «Braucht gute Forschung Demokratie?» lieferte viele Antworten.
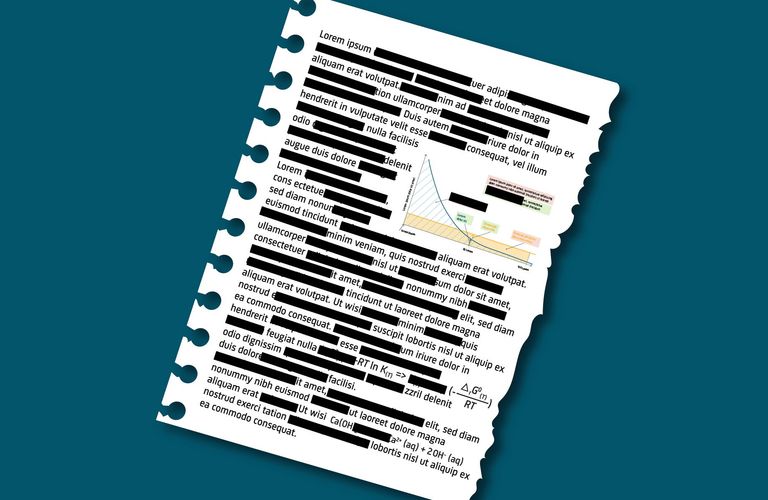
Astrid Tomczak-Plewka
Spätestens als ein Mann im Hotel Kreuz in Bern das Wort ergriff, lag ein Hauch James Bond in der Luft: Der Mann heisst Florian Lüthy. Er ist Steuerungsverantwortlicher Spionageabwehr beim Nachrichtendienst des Bundes NDB. Und seine Einschätzung ist deutlich: «Wir leben in unsichereren Zeiten als während des Kalten Krieges mit der Polbildung zwischen China und den USA und diversen anderen Krisen.» Er appellierte an die Wissenschaft: «Akademische Freiheit bringt Verantwortung mit sich. Wenn die Forschungsdaten nicht genügend gesichert sind, können sie z. B. zur Weiterentwicklung eines Waffenprogramms woanders dienen.» Das Votum des Nachrichtendienstmannes stand fast am Ende einer zweistündigen Veranstaltung, in der Fachleute die akademische Freiheit definierten, aufzeigten, wie und wo sie bedroht ist und wie Wissenschaftler:innen damit umgehen können.
Wie prekär es um diese Freiheit – nämlich die Freiheit zu lehren, die Freiheit zu lernen und die Freiheit, Forschungsergebnisse ohne Einschränkungen zu publizieren – steht, erläuterte Martina Caroni, Juristin der Universität Luzern und Delegierte für Menschenrechte der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Zwar sei die Akademische Freiheit als Grundrecht in vielen Ländern in der Verfassung verankert. Allerdings könnten die meisten Grundrechte eingeschränkt werden. «In Bezug auf die akademische Freiheit wird es immer prekärer», hielt Caroni fest. «So gibt es Einschränkungen wegen der Inhalte von Forschung.» Als europäische Beispiele nannte sie die Türkei und Ungarn.
Wissenschaft als geopolitische Schachfigur
Welche roten Linien auch in der Schweiz – zum Teil unbewusst – überschritten werden, zeigte Ralph Weber in seinem Input zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China auf. Weber ist Professor für European Global Studies am Europainstitut der Universität Basel und China-Spezialist. Die akademische Welt ist seit vielen Jahren im Visier der asiatischen Grossmacht. So gibt es chinesische Talentrekrutierungsstationen in der Schweiz und Talentrekrutierungsanlässe an verschiedenen Schweizer Hochschulen. Das sei oft eine Massnahme gegen den Brain Drain im «Mutterland», so Weber. «Aber es werden dabei auch Amerikanerinnen, Briten oder Deutsche angesprochen oder Personen aus dem militärischen Bereich.» Wie sollen Universitäten und Forscher:innen dieser Situation begegnen? «Wer mit chinesischen Partnern arbeitet, muss die Sachzwänge verstehen», so der Experte. Die liberaldemokratische Antwort liege darin «selbstverantwortliche, aber informierte Kooperation» zu praktizieren. «Einfach auf persönliches Vertrauen zu setzen, ist naiv. Wir brauchen eine Anlaufstelle für Wissenschaftler:innen, die sich eine Kooperation mit Partnern in China überlegen.»
Dass sich die Grosswetterlage auch auf dem wissenschaftsdiplomatischen Parkett geändert hat, erläuterte Jan Marco Müller, Koordinator Science Diplomacy der EU-Kommission: «Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Forschung und Innovation wieder wie im Kalten Krieg eine Spielfigur auf dem geopolitischen Schachbrett sind.» Die traditionell durch die Wissenschaft gemanagten «globalen Allmende Polargebiete, Tiefsee und Weltraum» würden zunehmend politisiert, militarisiert und ökonomisiert. Trotz dieser eher düsteren Ausgangslage wagte der Wissenschaftsdiplomat einen vorsichtig optimistischen Schluss. «Wir sollten nicht vergessen, dass die Sprache der Wissenschaft eine der letzten universellen Sprachen ist, die wir noch haben.»
Zwischen Kooperation und Vorsicht
Wie schwierig der Balanceakt zwischen akademischer Freiheit und (Daten-)Sicherheit in der Praxis zuweilen ist, zeigte sich im anschliessenden Podium. Sabin Bieri ist Direktorin am Centre for Development and Environment CDE der Universität Bern, das unter anderem in Laos und Ruanda zusammen mit lokalen Partnern forscht. «Wir stehen dauernd unter Beobachtung», sagte sie. Für sie habe die Sicherheit der Forschunspartner:innen oberste Priorität. «Wir haben auch schon eine Autorin aus einer Publikation gestrichen, um sie zu schützen.» Sie betonte aber auch, dass das CDE durch die jahrelange Arbeit vor Ort, beispielsweise in Laos, auch ein gewisses Vertrauen der Regierung geniesse. Trotzdem: «Auch wenn wir mit der Regierung gut zusammenarbeiten, müssen wir vorsichtig sein.»
Auch für Laurent Goetschel, Direktor der Schweizerischen Friedensstiftung swisspeace und Professor für Politikwissenschaft an der Universität Basel, ist klar, dass Forschung «mit dem jeweiligen System interagieren muss, im Bewusstsein, dass in anderen Ländern die akademische Freiheit nicht gleich definiert ist wie bei uns.» Das führte die Moderatorin – und wohl auch viele der rund 100 Publikumsgäste im Saal – zu der Frage, ob unter diesen Bedingungen die Zusammenarbeit mit repressiven Staaten überhaupt noch sinnvoll ist. Thierry Strässle, Stabschef und stellvertretender Direktor am Paul Scherrer Institut PSI lieferte darauf eine klare Antwort: «Wir als westliche Demokratien begegnen Ländern wie China mit Skepsis, aber wenn wir nichts mehr tun, ist unsere Forschungsfreiheit eingeschränkt. Wir brauchen den Austausch für Diversität.»
Dass dieser Austausch essenziell ist, darin waren sich alle einig. Über die Grenzen der Kooperation gab es hingegen Diskussionsbedarf. So betonte Laurent Goetschel: «Ich hatte schon bewusst Kontakt zu ausländischen Nachrichtendiensten. Ich kann mir nicht vorstellen, inwiefern das bessere Verständnis über die Position der Schweiz zum Nachteil der Studierenden oder der Schweiz sein kann.» Nachrichtendienstmann Florian Lüthy hatte eine konziliante Antwort: «Ich bin nicht dagegen, dass Sie das tun. Ich will nur, dass Sie sich bewusst sind, wo Bedrohungen sein könnten.»
Spätestens nach dieser Runde wurde deutlich, dass es keine eindeutige Antwort auf die Frage gibt, ob gute Forschung Demokratie braucht. «Spitzentechnologische Forschung kann in einem autokratischen System schneller zum Ziel kommen», sagte Thierry Strässle. Was jedoch auch deutlich wurde: «Forschung bringt Verantwortung mit sich», wie Jürg Pfister, Generalsekretär der SCNAT in seinem Fazit betonte. «Und wir müssen vermehrt für die akademische Freiheit einstehen.»